Am 26. März 2020 gab die Swisscom bekannt, Standortdaten aus ihrem Mobilfunknetz dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) zur Verfügung zu stellen.[1] Was noch vor wenigen Wochen wegen datenschutzrechtlichen Überlegungen für Furore sorgen könnte, stiess in der Gesellschaft auf Zustimmung. Das BAG gab an, dass es damit prüft, ob die vom Bundesrat angeordneten Massnahmen zum Schutz vor Pandemie eingehalten wird. Da die Daten anonymisiert und aggregiert seien, könne keine Rückschlüsse auf Einzelpersonen gezogen werden.[2] Weshalb diese Aussagen keine Empörung auslösten, liegt auf der Hand. Die grossen Datenmengen wurden offensichtlich für das Wohl der Gesellschaft gesammelt.
Die Auswertung von grossen Datenmengen hat auch eine Schattenseite. Im Jahr 2018 wurde Facebook wegen des Cambridge-Analytica-Skandals angeklagt. Zugunsten von Donald Trump setzte Letztere Daten von bis zu 87 Millionen Facebook-Nutzern ein.[3] Cambridge Analytica erstellte Psychogramme von 220 Millionen US-Bürgern.[4] Das Magazin, früher Tages-Anzeiger-Magazin, veröffentlichte einen Artikel, welcher behauptete, dass Cambridge Analytica mit ihrem Modell die US-Wahl manipulierte.[5] Dieser Fall zeigt eine andere Seite von Big Data.
Die beiden Fälle drehen sich um das Modewort Big Data. Duden definiert diesen Begriff mit folgenden Worten. «riesige Datenmengen, Technologien zur Verarbeitung und Auswertung riesiger Datenmengen». Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit diesem Begriff. Der erste Teil widmet sich der terminologischen Klärung und der juristischen Fragestellung. Darauf aufbauend, wird im zweiten Teil die schweizerischen und europäischen Datenschutzgesetzgebungen diskutiert. Denn Big Data beschäftigt seit längerer Zeit die Datenschutzbeauftragten der europäischen Staaten. Die EU erkannte das Problem vor mehreren Jahren und hat u.a. aus diesem Grund die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) erlassen. In der Schweiz ist die Totalrevision des geltenden Datenschutzgesetzes (DSG) seit 2017 im Gange. Schliesslich setzt sich die Arbeit mit Chancen und Herausforderungen der Big-Data-Thematik auseinander.
Big Data: Begriffserklärung
Laut dem Eidgenössischen Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragten (EDÖB) steht Big Data «für eine grosse Datenmenge aus vielfältigen Quellen, die mit hoher Verarbeitungsgeschwindigkeit erfasst, gespeichert und für unbestimmte Zwecke auf unbestimmte Zeit für Auswertungen und Analysen verfügbar gemacht werden». Die Auswertung von riesigen Datenmengen sei mit der technologischen Entwicklung erst möglich geworden. Es sei ohne weiteres möglich geworden, Daten über eine lange Zeit aufzubewahren und für beliebige Zwecke in der Zukunft zu verwenden. Nach dieser Definition stehen vier Elemente im Vordergrund.[6]
Datenschutzgesetzgebung in EU und in der CH
Big Data stellt eine juristische Herausforderung dar. Beispielsweise muss aus juristischer Perspektive erörtert werden, wie zwischen personenbezogenen und anonymen Daten unterscheiden werden kann. Darüber hinaus muss erörtert werden, ob ein Unternehmen, das auf riesiger Datenmenge sitzt, befugt ist, die Daten zu veräussern. Da die Devise «Data is the new oil» mittlerweile in aller Munde ist, hat diese Frage eine besondere Bedeutung.
Die DSGVO vom 27. April 2016 ist seit dem 25. Mai 2018 in Anwendung. Sie regelt die Datenschutzvorgaben in der EU. Art. 1 Abs. 1 DSGVO besagt, dass diese Verordnung Vorschriften zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten enthält. Mit anderen Worten setzt die DSGVO einen Bezug zur natürlichen Person bei der zu verarbeitenden Daten voraus. Bei der Überprüfung, ob riesige Datenmengen die Datenschutzvorgaben der EU verletzten, muss überprüft werden, ob es sich um personenbezogene Daten handelt. Falls die vorliegenden Daten anonymer Natur sind, ist Auswertung unbedenklich.
In der Schweiz ist dagegen das Datenschutzgesetz (DSG) vom 19. Juni 1992 noch in Anwendung. Am 15. September 2017 wurde der Antrag auf Totalrevision dieses Gesetzes eingereicht.[7] Das neue Gesetz bezweckt die Stärkung der Rechte der betroffenen Personen und erweitert Pflichten für Datenbearbeiter.[8] Damit passt sich der Schweizer Gesetzgeber seinen Datenschutz der DSGVO. Noch hinkt die Schweiz ihren Datenschutzregelungen hinterher. Trotzdem werden die personenbezogenen Daten unter der gegenwärtigen Datenschutzregelung geschützt.
Chancen und Risiken
Big Data wurde für unsere Gesellschaft und Wirtschaft unentbehrlich. Mit weiteren technischen Entwicklungen wird es allmählich an Bedeutung gewinnen. Die Einführungsfälle machen deutlich, dass Big Data sowohl Chancen als auch Risiken für die Gesellschaft darstellt. Einerseits bietet es relevante Unterstützung bei der Bekämpfung einer Pandemie, andererseits stellt es eine Gefahr für die Demokratie dar.
Um Chancen, Risiken und den Handlungsbedarf in diesem Bereich zu erörtern, hat der Bund relativ früh Prof. Dr. Thomas Jarchow und Beat Estermann beauftragt, eine Studie durchzuführen. Laut dieser Studie bietet Big Data wichtige Vorteile beim Gewinnen neuer Erkenntnisse und beim Entdecken neuer Zusammenhänge an. Zudem könne es verbesserte Prognosen in ganz unterschiedlichen Bereichen zur Verfügung stellen. Es könne ausserdem Abläufe optimieren und faktenbasierte Entscheide verbessern. Dem gegenüber geben die Autoren an, dass Daten-Missbrauch und Entwicklung der unkontrollierten Eigendynamik der Systeme von der Gesellschaft als Risiko wahrgenommen werde. Aus diesem Grund schlagen sie drei Massnahmen vor. Erstens soll eine nationale Dateninfrastruktur aufgebaut und gepflegt werden. Dieses System soll Daten zur freien Weiterverwendung bereitstellen. Damit folgen sie dem Open-Data-Prinzip. Zweitens sollen Massnahmen zum Schutz vor Missbräuchen angeordnet werden. Damit fordern sie den Gesetzgeber auf, Datenschutzregeln für die Privatwirtschaft zu verschärfen. Schliesslich regen sie die Umsetzung des Prinzips der persönlichen Datenhoheit an, was der Vision der My-Data-Initiative entspricht. Danach soll der Mensch befähigt werden, die Kontrolle über ihre Daten besser ausüben können.[9]
Konklusion
Durch die technische Entwicklung ist die Handhabe riesiger Datenmengen erst möglich geworden. Rechtlich betrachtet steht im Zentrum die Frage, ob die zu analysierenden Personendaten bestimmbar sind, im Zentrum. Sowohl die EU als auch die Schweiz betrachten die Auswertung anonymisierter Daten als unbedenklich. Jedoch greift diese Betrachtung zu kurz. Denn der Missbrauchsgefahr kann damit nicht entgegengewirkt werden. Vielmehr bedarf es der Gründung staatlicher Institutionen, die riesige Datenmengen zur freien Weiterverwendung bereitstellen.
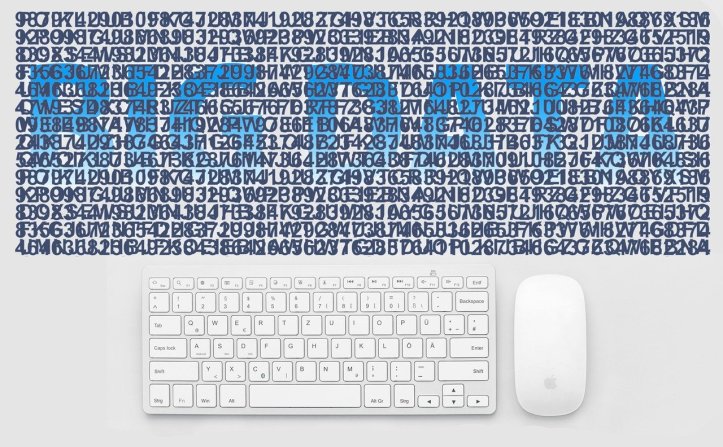
Bild von Gerd Altmann
[1] https://www.nzz.ch/technologie/swisscom-liefert-standortdaten-von-handys-an-den-bund-ld.1548504
[2] https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/das-bag/aktuell/news/news-26-03-2020.html
[5] https://www.dasmagazin.ch/2016/12/03/ich-habe-nur-gezeigt-dass-es-die-bombe-gibt/
[7] https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20170059
[8] https://www.hwzdigital.ch/big-data-meets-dsgvo/
[9] Jarchow/Estermann, Big Data: Chancen, Risiken und Handlungsbedarf des Bundes, 26. Oktober 2015, Berner Fachhochschule, Seite 83 – 84.
